- Homo Deus von Y.N. Harari - Versuch einer Einordnung
- Fidelio - Der Ruf nach Freiheit
- Alexej Nawalny - bekennender Christ
- Missbrauchsstudie in meiner ev. Kirche
- Gier - Kernproblem von Umweltzerstörung und Klimawandel
- In unserer Begrenztheit dem Bösen standhalten
- Gedanken
- Bonhoeffer: "... dem Rad selbst in die Speichen zu fallen!
- Putins Aggression in der Ukraine
- Der Wald steht schwarz und schweiget - Matthias Claudius
- Der (doppelte) Regenbogen - Symbol der Treue Gottes
- Zur Ruhe kommen ...
- Aktive Verortung - Innere Vernetzung
- Welt im Umbruch - Gedanken zum "Ganzen" Advent 2015
- Die Kirche im Dorf lassen!
- Kirchenkritik im Leitartikel der NN 171223
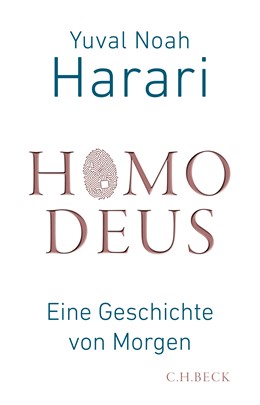
Homo Deus - Die Geburt des Menschenautomaten
Versuch einer Einordnung
von Wolfgang Kornder
Homa Deus
Eine Geschichte von morgen
C-H-Beck
14. Auflage 2024
Von Yuval Noah Harari
Vorbemerkung:
Homo deus ist ein Besteller, was die 14. Auflage der deutschen Übersetzung ja allein schon zeigt. Zuvor hat sich Harari bereits mit „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ und anderen Büchern weltweit einen Namen gemacht.
Es hat sicher die eine oder andere kritische Stimme zu diesem bereits 2017 erschienenen Buch gegeben. Ich habe nicht sonderlich intensiv danach gesucht, sondern mir eine eigene Meinung dazu gebildet.
Ich gehe das Buch in Abschnitten durch und füge zu jedem Abschnitt meine Anmerkungen, die ich mir als Christ und einigermaßen gebildeter Mitteleuropäer dazu gemacht habe.
Gedanken und Überlegungen zu Homo Deus
Beim Lesen des ersten Kapitels (S. 9-38) kam durchaus Überraschendes, aber auch Fragezeichen: Heutzutage würden deutlich weniger Menschen eines gewaltsamen oder eines Hungertodes sterben als früher und die Fettleibigkeit fordere heute mehr Opfer als der Hungertod. Größere Bedrohungen durch Epidemien seien die „Folge menschlicher Dummheit und Gleichgültigkeit“. Und: „Die dritte gute Nachricht ist, dass auch Kriege verschwinden.“ Den Angriff Russlands auf die Ukraine gab es 2016 noch nicht und so kann Harari vom „Neuen Frieden“ (im Druck hervorgehoben) reden. Hunger, Krankheiten und Krieg hätten ihren Schrecken verloren. Naja, bis zur Coronapandemie waren es noch ein paar Jahre hin.
Und dann kommt in seinem Vorspann schließlich doch noch die Umweltkrise als Folge des Wachstums. Der Mensch will immer mehr und „Erfolg gebiert Verlangen“ und so komme es zur Umweltzerstörung. Unterm Strich aber sei die menschliche Entwicklung eine Erfolgsgeschichte und „die nächsten Ziele der Menschheit werden wahrscheinlich Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit sein“. „Im 21. Jahrhundert werden die Menschen vermutlich ernsthaft nach der Unsterblichkeit greifen.“ Das „Recht auf Leben“ (im Druck hervorgehoben), wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als zentrales Ziel aufgeführt ist, kommt damit in den Fokus. Die Überschrift zu diesem Kapitel (S. 39 – 51) lautet passend „Die letzten Tage des Todes“. Ohne den Tod hätten wir eine Welt ohne die großen Religionen – „das wäre eine Welt auch ohne Himmel, Hölle oder Reinkarnation“. Und in Frontstellung zu den klassischen Religionen sei der Tod kein „metaphysisches Mysterium“, sondern „ein technisches Problem, das wir lösen können und lösen sollten“. Die moderne Wissenschaft zumindest halte das für lösbar. Und schließlich sei das „Recht auf Leben“ aus den Menschenrechten grundsätzlich zu verstehen und nicht auf ein bestimmtes Lebensalter, etwa auf 90 Jahre, begrenzt. „Unsterblichkeit ist in.“ Allerdings werde der sich anbahnende „Kampf um die ewige Jugend“ „erbitterte politische Konflikte“ auslösen.
Nach der Unsterblichkeit gelte es, „den Schlüssel zum Glück zu finden“. (52-72) Dazu gehöre seit dem 19. Jhd. natürlich Bildung, z.B. in Schulen, die aber eher „gut ausgebildete und gehorsame Bürger“ hervorbrächten. Das alles mache aber die Menschen nicht glücklicher, sondern stärke eher den Staat. Nach Harari seien wir aber nicht dazu da, „dem Staat zu dienen – er ist da, um uns zu dienen“. Aber selbst wenn das erkannt wäre, sei es mit dem Glück eine schwierige Sache.
Nach Seitenhieben auf die großen Religionen kommt er dann zu der Erkenntnis: „Das Einzige, was Menschen unglücklich macht, sind unangenehme Empfindungen in ihrem eigenen Körper.“ Und diese körperlichen Empfindungen könne man mit biochemischen Eingriffen steuern. Ganz konkret verweist er hier auf den Einsatz von Ritalin bei hyperaktiven Schülern, die damit normal am Unterricht teilnehmen können und aufgrund ihrer Störung nicht von vorneherein unglücklich werden würden. Und weil dieses Streben nach biochemisch begründetem Glück ein weltweites Phänomen sei, werde damit der Drogenkonsum und damit die Drogenkriminalität angeheizt. Das biochemische Glücksstreben sei durchaus schwer zu kontrollieren, wie ja der Drogenkonsum zeige, aber es sei ein möglicher Weg zum Glück. Das gelte, auch wenn Epikur, den er durchaus schätzt, vor allzu naiven Vorstellungen warne, den Weg dahin als „harte Arbeit“ beschreibe und Buddha in seinen vier Grundsätzen in der Lebensgier das Hauptproblem für das menschliche Leiden sehe. Das Streben nach „angenehmen Empfindungen“, sprich dem Glück, sei weltweit auf dem Vormarsch und die Biochemie werde uns dabei helfen.
Anmerkungen:
Ganz abgesehen davon, dass die körperlich gedachte Unsterblichkeit bislang ein frommer Wunsch ist, bilden die Überlegungen zum Glück ein zusammengewürfeltes Sammelsurium. Glück auf angenehme körperliche Gefühle zu reduzieren, ist eine völlig unzulässige Einengung. Kennen z.B. kranke Menschen, die Schmerzen und ungute Gefühle erleiden, kein Glück? Glück zu definieren ist ein bislang geisteswissenschaftlich kaum leistbares Unterfangen. Und die vier Hauptsätze des Buddhismus mit einem biochemischen Strich zu relativieren, halte ich für gewagt. Der von Harari selbst eingebrachte Hinweis auf den Drogenkonsum, sollte hier nachdenklich machen.
Ohne Zweifel können Drogen, also biochemische Substanzen, tolle Gefühle und Zustände hervorrufen, aber genauso auch Horrortrips. Und außerdem machen viele Drogen abhängig und zerstören oftmals regelrecht Menschen psychisch und physisch und als Folge ganze Familien. Auf eine solche Basis das Glück aufzubauen, ist jenseits von Gut und Böse. Auch die bereits kritisierte Fettleibigkeit sollte Harari nachdenklich machen, denn oftmals fressen Menschen in sich hinein, weil das angenehme Gefühle macht. Solches Streben nach Glück führt demnach genau zum Gegenteil und zu höherer Sterblichkeit, vor allem durch Adipositas (Fettsucht), Alkoholgenuss und Rauchen, und schon gar nicht zur Unsterblichkeit.
Ob er das Recht auf Leben in den allgemeinen Menschenrechten mit dem Streben nach Unsterblichkeit richtig interpretiert, darf getrost bezweifelt werden. Und seine These, dass der Tod kein metaphysisches sondern ein technisch lösbares Problem sei, ist nicht nur eine reine Behauptung, sondern deutet schon hier die Reduktion des Menschen auf eine Art technischen Apparat an, „bis sie schließlich keine Menschen mehr sind“ (das Zitat von Harari stammt aus dem nächsten Block). Die von Harari "Entwicklung“ genannte Reduktion werde – wie sich später noch zeigen wird - vor allem der breiten Masse schaden, nicht aber der Elite.
Harari merkt natürlich selbst, dass er sich ein sehr hohes Ziel gesteckt hat und so beginnt er das nächste Kapitel (72 – 111) mit der damit unweigerlich verbundenen Konsequenz: „Mit ihrem Streben nach Glück und Unsterblichkeit versuchen die Menschen in Wirklichkeit, sich zu Göttern zu erheben.“ Es gehe um ein „Upgrade“ (im Druck hervorgehoben) von Menschen auf drei Wegen: durch Biotechnologie, durch Cyborg-Technologie und durch die Erzeugung nicht-organischer Lebewesen.
Biotechnologie (Bioengineering) werde unsere „Gehirnströme“, unser „biochemisches Gleichgewicht“ verändern und sogar „Gliedmaßen“ wachsen lassen. „Die Entwicklung von Cyborgs wird noch einen Schritt weiter gehen und den organischen Körper mit nicht-organischen Apparaten verschmelzen“. Und noch dazu hofft Harari, dass „vollkommen nicht-organische Lebewesen“ entwickelt werden können.
Nach Harari kommen da die alten Systeme der Religionen und der Philosophie nicht mehr mit. Aber in diesem umwälzenden Prozess wird sich der homo sapiens zum homo deus (kursiv im Original) weiterentwickeln. Wir können „Übermenschen“ schaffen, die weit mehr können als die alten Götter. „In ihrem Streben nach Gesundheit, Glück und Macht werden die Menschen ganz allmählich zuerst eines ihrer Merkmale, dann noch eines und noch eines verändern, bis sie schließlich keine Menschen mehr sind.“ Dabei ist Harari bewusst, dass z.B. über Genveränderungen „Übermenschen (oder eine gruselige Dystopie)“ entstehen können.
Bei all diesen angedachten Entwicklungen spiele „Wissen“ eine zentrale Rolle. Allerdings wisse man nie, wie Wissen angewendet wird und welche Reaktionen es hervorruft. Deshalb lasse sich Zukunft nicht vorhersagen. So könne trotz besten Wissens eine völlig ungerechte oder fragwürdige Welt entstehen.
Nach Harari werde die Welt in den letzten drei Jahrhunderten von der Religion des Humanismus beherrscht, „der das Leben, das Glück und die Macht von homo sapiens (kursiv im Druck) heiligt“. Die Heiligkeit des Lebens stellt Harari mit dem Hinweis auf die Debilität mancher alter, mit viel Aufwand am Leben erhaltener Menschen in Frage: „Was genau ist daran so heilig?“ Und in solchen Fehleinschätzungen des „humanistischen Traumes“ liege wahrscheinlich auch der Zerfall des Humanismus, den er als „vorherrschende Weltreligion“ der letzten Jahrhunderte sieht. Der Humanismus habe nicht erkannt, dass der Mensch ein Tier unter Tieren sei. Und wenn uns die zukünftigen Übermenschen so behandeln werden wie das Tier Mensch die übrigen Tiere behandelt hat, dann hätten wir nichts zu lachen. Und eine weitere Fehlannahme sei das „humanistische Credo …, wonach sich das Universum um die Menschheit dreht und Menschen der Quell allen Sinns und aller Macht sind“. Das werde sich grundlegend verändern, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, so wie sich Menschen aus dem Mittelalter nicht vorstellen konnten, dass Gott tot sein (werde). Dabei sei heute rückblickend der „Tod Gottes“ eine „positive Entwicklung“.
Anmerkungen:
Die Entstehung des neuen Übermenschen, die er später noch mit vielen Einzelbeispielen untermauern wird, ist bislang reine Fiktion. Nietzsche, auf den er immer wieder mal Bezug nimmt, hat ja auch schon davon phantasiert. Und ganz sicher war das, was dann die Nazis mit ihrer Rassentheorie daraus gemacht haben, nicht in seinem Sinne. Nietzsche ging es um eine innere Haltung, die eine hohe Selbstdisziplin und Arbeit an sich selbst erfordert. Dass das bei vielen Menschen nicht funktioniert, liegt auf der Hand. Die Nazis hingegen sind von den modernen Versuchen, den Übermenschen zu schaffen, gar nicht so weit entfernt. Gentechnik gab es damals noch nicht, aber die Vererbung und die damit verbundene Auslese und die Rassentheorie hatten sie ganz klar auf ihrer Agenda. Schon allein aufgrund dieses historischen Befundes wäre ich sehr vorsichtig, einen Übermenschen schaffen zu wollen, egal ob über Bioengineering oder mit technischen Bauteilen.
Völlig daneben liegt m.E. Harari, wenn er den Humanismus als die Weltreligion der letzten drei Jahrhunderte ansieht. Er scheint einen ganz eigenen, eigenartigen Religionsbegriff zu verwenden, der mehr verwirrt als klärt (dazu später noch mehr). Ich wüsste nicht, wo das aufscheint, dass der Humanismus die Weltreligion der letzten drei Jahrhunderte war. Der Humanismus würde sich auch nie als Religion bezeichnen, ist er auch nicht. Zu einer Religion gehört Transzendenz, ggf. ein Gott, und das fehlt beim Humanismus. Theologen reden völlig unabhängig vom Humanismus in bestimmten Fällen von Ersatzreligionen, wenn z.B. ein Führer oder Guru oder ihre Lehren gottähnliche Verehrung erfährt, wie z.B. bei Hitler oder Stalin. Das gilt aber nicht für den Humanismus.
Und weiter überschätzt Harari „den Tod Gottes“ – einer seiner Lieblingsgedanken -, den Nietzsche verkündet hat, denn nach wie vor glaubt der überwiegende Teil der Menschheit an einen Gott (Gott-sei-Dank), - aber das ignoriert Harari einfach bzw. ordnet es als noch laufende Übergangsphase ein.
Zukunft vorherzusagen sei schwierig, weil man nie wisse, wie Wissen angewendet wird. Da kann man nur zustimmen und da sind wir bei einem Zug des Menschen, der sich offensichtlich technisch über Algorithmen – ein zentraler Schlüsselbegriff bei Harari - nicht einfangen lässt. Der menschliche Wille entscheidet, wie er will! Aber dieser menschliche Wille lässt sich in der Blackbox des Menschen naturwissenschaftlich genauso wenig finden wie die anderen großen Themen (Freiheit, Bewusstsein, Glaube, …) auf die er später noch zu sprechen kommt. Und zumindest seit Freud weiß man, dass das Unbewusste am Willen vorbei mitregiert.
Im ersten Hauptteil seines Buches, „Homo sapiens erobert die Welt“ (S. 113 – 239 = Kapitel II + III) verweist er auf die biologisch gesehen geringen Unterschiede zwischen Tier und dem Tier Mensch und wie fragwürdig die Inbesitznahme der Welt durch das Tier Mensch war.
Im Anthropozän (seit ca. 70000 Jahren) übernahm das Tier Mensch in beispielloser Weise die Macht auf unserem Planeten. Solange der Sapiens (Harari bezeichnet damit den homo sapiens) animistisch war, ging alles noch ganz gut. Es gab keine brachiale Zerstörung der Natur. Diese ursprünglichen, animistischen Menschen bezeichnet Harari als Schlangenkinder, um die enge Verbindung von Menschen, die damals angeblich als Abkömmliche von Schlangen gesehen wurden, zu verdeutlichen. Nach seiner Meinung – Anmerkung der Redaktion: nicht nach dem Mainstream der Namenserklärung - bedeutet „Eva“ hebräisch „Schlange“. Die Erschaffung der Welt durch Gott und die darin enthaltene Sonderstellung des Menschen sieht er als unheilvolle Abkehr vom Animismus hin zu einem Gottesglauben, zum Theismus. Letzterer sei im Kontext der Landwirtschaft entstanden, in deren Folge das Elend der Tiere, der wilden und vor allem der domestizierten, begann. Er demonstriert das ausgiebig an der Haltung von Muttersauen in Kastenständen, wo Muttersauen und Ferkel absolut nicht artgerecht gehalten werden und wie viele andere domestizierte Tiere extrem leiden.
Sehr ausführlich stellt Harari dar, dass wir Menschen das Empfinden und die Emotionen von Tieren weitgehend ignorieren und ihnen damit unendliches Leid zufügen. Die Emotionen von Tieren seien biochemische Algorithmen, wie sie sich genauso auch beim Tier Mensch finden. Ganz klar formuliert er in diesem Kontext: „Menschen sind Algorithmen“, so etwas wie eine naturwissenschaftlich fassbare Maschine. „Was wir als Sinnesempfindungen und Emotionen bezeichnen, sind in Wirklichkeit Algorithmen.“ Da würden „Rechenvorgänge“ ablaufen, die sich dann als „Gefühl“ zeigen.
Trotz Sigmund Freud habe sich der Behaviorismus bis ins 20 Jhd. gehalten und die emotionalen Anteile in der Sozialisation und Erziehung negiert und damit auch im menschlichen Kontext viel Leid erzeugt. Diese Kaltherzigkeit habe sich in der „landwirtschaftlichen Revolution“ entwickelt und gehalten, verbunden mit der theistischen Religion, die sich mit der Landwirtschaft treibenden Menschheit entwickelt habe. Und diese Religionen, die nach Harari angeblich den Menschen heilig sprachen, hätten diesem eine Sonderstellung gegeben, mit der das Tierleid gerechtfertigt worden sei. Das Herrschen über die Tiere aus Gen 1, 26 fehlt natürlich nicht, die Gott-Ebenbildlichkeit auch nicht. So sei der Mensch zum Leidwesen der Tiere zur „Krone der Schöpfung“ geworden. Zudem sei damit verbunden gewesen, dass nur der Mensch im Gegensatz zu den Tieren eine Seele hätte.
Nachdem es keine Seele gebe, sei damit dieses Problem gelöst. Aber was mache dann das Besondere aus, das den Siegeszug des Menschen, die „Herrschaft über den Planeten Erde“ erkläre? Es sei seine Fähigkeit zur Kooperation, die den Tieren einfach in diesem Maße fehle.
Das Zusammenspiel von theistischer Religion und Mensch sieht Harari dann so: „Die Götter schützen und mehrten die landwirtschaftliche Produktion, und im Gegenzug mussten die Menschen diese Produkte mit den Göttern teilen. Diese Abmachung diente beiden Parteien, allerdings auf Kosten des übrigen Ökosystems.“
„Die Agrarrevolution war somit eine ökonomische und eine religiöse Revolution.“ Das alles ging zu Lasten der Tiere und der Natur und setzte sich in der unterschiedlichen Behandlung verschiedener Klassen von Menschen fort: „Der Bauernhof wurde somit zum Prototyp neuer Gesellschaften mit allem Drum und Dran: aufgeblasenen Herren, minderwertigen Rassen, die man ausbeuten durfte, wilden Tieren, die es auszurotten galt, und einem großen Gott, der über allem thronte und dem ganzen Arrangement seinen Segen erteilte.“
Die moderne Wissenschaft und Industrie vollendete dieses Werk und schaffte schließlich die Götter ab, auch wenn das Ganze nach der Bibel schöpfungstheologisch im Garten Eden mit dem Apfel und Adam und Eva begann. „Die Welt war nunmehr eine One-Man-Show.“ „Die Menschheit … erwarb enorme Macht ohne irgendwelche Verpflichtungen.“ Der Mensch hatte sich an die Stelle Gottes gesetzt.
In dieser Phase entstand die „humanistische Religion“, der Liberalismus, Kommunismus und der Nationalsozialismus, die allesamt der Meinung waren, „dass homo sapiens (kursiv im Druck) über einen einzigartigen und heiligen Wesenskern verfügt.“ Und diese Sonderstellung rechtfertige nach dem Tod Gottes die Ausbeutung der Tiere und der Natur, die früher von Gott oder Göttern abgesegnet war.
Anmerkungen
Am Pranger steht die Agrarrevolution und „der Bauernhof“, denn damit begann die Zerstörung und Ausbeutung der Natur und das Leid der Tiere. Die agri-cultura vor etwa 12000 Jahren war die erste bedeutende „Kultur“ der Menschheit. Mit dem Ackerbau ermöglichte sie Versorgung von ganz vielen Menschen und die Weltbevölkerung nahm von da an rapid zu. Rückblickend kann man sagen, die agriculture war ungeachtet ihrer Begleiterscheinungen der Startschuss aller menschlicher Kultur und bis heute brauchen die 8 Milliarden Kulturmenschen genügend zu essen, sonst droht der Hungertod, auch der überwältigenden Masse der Menschen, die nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sind. Wer heute die Landwirtschaft pauschal zum Sündenbock für Tierleid und Umweltzerstörung macht ohne zu erklären wie man die 8 Milliarden Menschen ernährten kann, hat nicht verstanden, dass unsere Kultur darüber hinaus grundsätzlich Raubbau mit der Natur und an den Tieren treibt, heute allen voran die Industrie und die energiefressenden Clouds und Rechenzentrum der modernen Wissenschaft.
Völlig unabhängig von agricultura, den theistischen Religionen und dem Humanismus, der mit seiner von Harari übertragenen Rolle als bestimmende Religion hauptverantwortlich für den Fortschritt und die problematischen Entwicklungen der Neuzeit sei, kommt die von Harari im Nebensatz erwähnte fehlende „Verpflichtung“ zur Sprache. Damit verbunden ist Verantwortung des modernen Menschen für all sein egozentrisches Tun als Erklärung für die Entstehung zentrale Probleme, was z.B. für die Umweltkrise oder die Ausbeutung von Tieren und Menschen am ehesten greift. Verantwortung aber setzt Werte voraus, nach denen man sich richtet. Im biblischen Beispiel von Adam und Eva (Gen 3) ist dieser Wertbereich mit der Erkenntnis von Gut und Böse bereits klar erkannt (Weiteres s.u.).
Die Begründung, dass angeblich nach Meinung vieler Christen der Mensch die Krone der Schöpfung aufgrund einer Seele sei – was in der Bibel nirgends behauptet wird - fällt natürlich zusammen, wenn es keine Seele gibt. Über Letzteres kann man ja trefflich spekulieren (dazu später). Dass aber der Mensch die Herrschaft über diese Erde angetreten hat, darüber nicht. Das ist einfach Realität. Gen 1,26 hat damit vor 2500 Jahren eine realistische Wahrnehmung und zutreffende Prophezeiung gemacht, ohne die cultura jeglicher Coleur nicht möglich gewesen wäre. Und ob diese Herrschafts-Realität über eine Seele, die menschliche Intelligenz (nach Harari eher nicht) oder gemäß Harari durch seine Fähigkeit zur Kooperation bedingt ist, ändert nichts an seiner Sonderstellung als Beherrscher der Welt, als „Krone der Schöpfung“, die er so gesehen einfach innehat. Harari merkt scheinbar gar nicht, dass er mit seiner eigenen Begründung, die These von der Krone der Schöpfung untermauert. Und offensichtlich merkt er auch nicht, dass die von ihm am Ende seines Werkes konstruierte Weltlenkung durch eine wie auch immer geartete „Elite“ von „Übermenschen“, nichts anderes wie eine „Krone der Schöpfung“ ist – wenn auch eine rein säkulare und zutiefst fragwürdige. Das macht die Sache aber nicht besser. Im Gegensatz zur rein säkularen Herrschaft ist religiöse allerdings an Verpflichtungen gebunden, für einem jüdischen König z.B. Gebote Gottes, auch wenn sie diese allerdings oftmals wenig überzeugend umsetzten. Immerhin schickt der erfundene und inzwischen angeblich verstorbene Gott ab und zu Propheten, wie den Nathan, oder Martin Luther oder Martin Luther King, um das Eine oder Andere zu korrigieren.
Aus der Adam-Eva-Erzählung Gen 3 stammt ja auch der Buchtitel (homo = Mensch, deus = Gott), denn dort heißt es in V 5: „Gott weiß vielmehr: „Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.“ Wer Gut und Böse unterscheiden kann oder könnte, der muss dafür Verantwortung tragen, das ist die Krux dieser tiefgründigen Aussage. Das setzt aber persönliche Entwicklung und Reife voraus. Interessanterweise taucht das Thema persönlicher Entwicklung und Reife oder gar so etwas wie die Bewusstseinsstufen von Kohlberg bei Harari nirgends auf. Bei ihm entwickeln sich „säkulare Religionen“ in großen Zeiträumen, der Einzelne und vor allem entwicklungspsychologische und da speziell psychoanalytische Entwicklungsschritte, scheinen keiner Erwähnung wert.
Zwischendurch kommt der Behaviorismus, der das Verhalten von Menschen und Tieren rein naturwissenschaftlich erklären will und damit voll auf der Linie von Harari liegt, unter die Räder. Nachdem der Mensch wie eine Maschine nach bestimmten Algorithmen funktioniere, müsste Harari eigentlich ein Fan des Behaviorismus sein, denn genau auf dieser Ebene arbeitet er ja. Aber wenn man zeigen will, dass kaltes technisches Vorgehen gegenüber Tieren etwas ganz Schlimmes ist, passt der technisch-kaltherzige Behaviorismus (Vorgriff: genauso wenig wie der von Harari favorisierte Dataismus) nicht so recht hinein und wird kurzerhand zu einer fragwürdigen Wissenschaft. Da muss man dann eher auf die Psychoanalyse Freuds setzen, die aber im Gegensatz zum Behaviorismus überhaupt nicht zu Hararis Denken passt, wie ich später noch zeigen werde.
Im Kapitel 3, „Der menschliche Funke“ (~ „Seele“)(161 – 239), nimmt sich Harari genauer die im Humanismus formulierte Sonderstellung des Menschen vor. Nach Harari sei dieser „Funke“ die monotheistisch postulierte „Seele“. Diesem „monotheistischen Mythos“ widersprächen die „jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse“. Kurz und bündig: Die Existenz einer Seele passe nicht zu den „Grundprinzipien der Evolution“, die ja von „gläubigen Monotheisten“ radikal abgelehnt werde. „Darwin (…) hat uns unserer Seelen beraubt.“ Harari geht davon aus, dass die Seele etwas „Unteilbares“ sein müsse. Evolution aber bedeute Veränderung, Entwicklung, nicht statisch Unteilbares wie eine den Tod überdauernde Seele. „Empfindung“, „Verlangen“, „Bewusstsein“, „Geist“ (alles Größen, die er später zu Grabe tragen wird) seien Größen der Evolution und darauf komme es an. Dabei ist Harari schon klar, dass „die Wissenschaft erstaunlich wenig über Geist und Bewusstsein“ weiß oder „wie eine Anhäufung elektrischer Gehirnsignale subjektive Erlebnisse erzeugt“. „Das ist die größte Lücke in unserem Wissen über das Leben.“ Aber er vertraue darauf, dass sich das ändern kann und werde.
Manche Wissenschaftler würden für das Zustandekommen von Erlebnissen eine „globalen Arbeitsraum“ postulieren, was natürlich nur eine Metapher sei. Die Mathematik habe für die Entstehung von Bewusstsein und Geist auch keine Lösung und „wie von Zauberhand entspringt (…) das Bewusstsein“. Und weil es für die Seele keine Belege gebe, hätten die Biowissenschaften die Seele kurzerhand entsorgt. Und Bewusstsein sei ein „nutzloses Nebenprodukt bestimmter Gehirnprozesse“, so etwas wie „eine Art geistiger Luftverschmutzung“. „Subjektive Erfahrungen“ seien aber durchaus relevant, denn sonst wären Folter und Vergewaltigungen ja überhaupt nicht schlimm.
Nach den Biowissenschaften seien „Organismen Maschinen“ und auch Freud sei davon beeinflusst, denn er entleihe viele Bilder für seine Psychoanalyse aus der Naturwissenschaft, im Speziellen aus der Mechanik. Computer seien technische Geräte, aber wer könne mit Sicherheit sagen, dass sie keine „Sinnesempfindungen oder Wünsche haben?“
Die Überlegenheit des Menschen werde auch mit seinem „Selbst“ oder mit seinem „Selbstbewusstsein“ begründet. Es gebe Meinungen, dass Tiere durchaus so etwas haben könnten, und Wissenschaftler streiten darüber, ob dafür bewusste Algorithmen oder „unbewusste“ oder „nicht-bewusste Algorithmen“ verantwortlich gemacht werden sollen.
Menschenmassen würden sich anders verhalten als kleine Menschengruppen. Massen würden mit „Drohungen und Versprechungen“ dazu gebracht, bestehende „Hierarchien und Netzwerke“ als „Ausfluss unvermeidlicher Naturgesetze oder göttlicher Gebote“ zu sehen.
Harari nimmt sich in diesem Kapitel auch das „Sinngeflecht“ vor. Die meisten Menschen würden davon ausgehen, dass „es nur zwei Arten von Realität gibt: objektive Realität und subjektive Realität.“ Zur objektiven Realität gehöre z.B. die Schwerkraft. Die subjektive Realität versucht er an hypochonderartigen Phantomschmerzen zu erklären: der zu Rate gezogene Arzt erklärt die Person für völlig gesund, der schmerzgeplagte Patient sieht seine Schmerzen ganz real. Das Empfinden des Patienten sei subjektive Realität.
Daneben gebe es „eine dritte Ebene der Realität, nämlich die intersubjektive.“ Die Erschaffung von Geld als Zahlungsmittel sei eine intersubjektive Wirklichkeit aufgrund einer gesellschaftlichen Absprache. So eine Abmachung könne aber zusammenbrechen, dann sei das Geld wertlos. Entscheidend sei, ob die Menschen „dran glauben“. Wenn sie das nicht mehr täten, lösen sich „Gesetze, Götter(n) und sogar ganze Imperien auf“. Obwohl solche Bereiche (wie z.B. Gott) Fiktionen seien, hielten Menschen daran fest, weil sie „unserem Leben Sinn geben“. „Sinn entsteht, wenn viele Menschen zusammen an einem gemeinsamen Geflecht von Geschichten weben.“ Man glaube das, was jeder glaubt. Und von Menschen erfundenen Geschichten und Glaubenssätze wie die Vorstellung einer Seele oder eines (religiösen) Himmels können sich natürlich auch auflösen und die Menschen erkennen schließlich, dass das alles nur „Ausfluss der Fantasie“ war.
Im Gegensatz zu Tieren, die nur in der objektiven Realität leben würden, habe der Sapiens mit solchen „Hirngespinsten“ (intersubjektiven Realitäten) die Herrschaft in der Welt an sich gerissen. Die intersubjektiven Realitäten seinen in den Geisteswissenschaften angesiedelt, während die Biowissenschaften so etwas „nicht wirklich anerkennen“. Und Harari formuliert hier als eine zentrale Aufgabe: Will man die Zukunft verstehen, „müssen (wir) die Fiktionen entschlüsseln, die der Welt einen Sinn geben“.
Anmerkungen
Im Kapitel 3 verwendet Harari viel Raum darauf, eine große Nähe zwischen dem Tier und dem Tier Mensch zu belegen, was heutzutage oftmals schon Allgemeinwissen ist. Das will er anhand zentraler geisteswissenschaftlicher Begriffe untermauern. Mit der „Seele“, die Tieren angeblich fehlt, hätten natürlich wieder mal die theistischen Religionen einen Unterschied manifestiert, der sich dann der Sache nach in der „Religion“ Humanismus fortsetzt.
Aber bei der Suche nach der Seele finden die modernen Wissenschaften und insbesondere die Biowissenschaften natürlich nichts. Die Annahme Hararis, die Seele müsse, da sie ja den Tod überdauere, unteilbar und damit auffindbar sein, ist allein schon blanker Unsinn. Und die Konstruktion, dass die Evolution auf Veränderung angelegt und schon allein deshalb eine „unteilbare“ Seele nicht möglich sei, muss man ja weiter auch nicht kommentieren. Dass ein Geisteswissenschaftler solche Argumentationen anführt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Zwischendurch sind die Seitenhiebe gegen die Christen, Theisten oder Religiösen an den Haaren herbeigezogen. So kenne ich selbst viele Christen, die die Evolutionstheorie für richtig halten und ich selbst habe als Religionslehrer meinen Schüler:innen nie etwas anderes erzählt. Schade, dass hier Harari lieber bei einer völlig undifferenzierten Betrachtung stehen bleibt, die der Realität nicht gerecht wird. Aber offensichtlich braucht er diese Einengung und dieses Feindbild.
Selbst säkulare Zeitgenossen müssen aber aufhorchen, wenn Bewusstsein als „geistige Luftverschmutzung“ abgewertet wird. Kohlbergs Bewusstseinsstufen sind folglich völlig unsinnig. Dass die Naturwissenschaften mit Bewusstsein nichts anfangen können, verstehe ich ja, dass aber ein Geisteswissenschaftler zu derartigen Abwertungen kommt, nicht. In der Pädagogik und Psychologie gibt es durchaus viele Ansätze, die die Entwicklung von Bewusstsein oder auch anderen großen Themen des Menschseins betrachten und in Ansätzen helfen, solches zu entwickeln. Eine liebevolle Zuwendung vor allem der ersten Bezugspersonen ist hier ganz zentral zu nennen. So entsteht psychoanalytisch gesehen Urvertrauen als Ausgangsbasis für menschliche, reife Menschen, die dann auch mit Gut und Böse eher umgehen können. Aber liebevolle, artgerechte Zuwendung taucht bei Harari nur bei den Ferkeln auf, die gewaltsam und viel zu früh von der Muttersau getrennt werden. Beim Menschen fehlen solche Bezugnahmen.
Völlig irritiert war ich, als er im Rückgriff auf Freud die „unbewussten Algorithmen“ aus dem Hut zaubert. Denn das „Unbewusste“, die bahnbrechende Entdeckung Freuds (die dritte Beleidigung der Menschheit), ist eine rein erschlossene Größe, deren Existenz sich nicht beweisen lässt – genauso wenig wie die „Seele“. Aber während die „Seele“ erfundener Unsinn der Theisten sein soll, weil sie sich ja (natur-)wissenschaftlich nicht finden lässt, muss das „Unbewusste“, das sich naturwissenschaftlich genauso wenig finden und beweisen lässt, zur Rettung von Hararis umfassender (m.E. völlig zu kurz greifenden) Algorithmen-Theorie herhalten.
Und dass Freud ganz viele Begriffe und Bilder aus der Naturwissenschaft und der Mechanik verwendet, zeigt nicht etwa Hochachtung und Zustimmung, sondern hat einen ganz einfachen Grund: Freud war Mediziner und die Medizin seiner Tage verstand sich als streng naturwissenschaftliche Disziplin. Ursache und Wirkung, naturwissenschaftlich objektiv belegt. Das war die Grundlage. Und dass dann Freud mit der Entdeckung des völlig unwissenschaftlichen „Unbewussten“ eine völlig andere Dimension betrat, war für Freud selbst und die Geisteswissenschaften eine Befreiung aus dem viel zu engen naturwissenschaftlichen Korsett und ein Quantensprung, der ihm weltweit Aufmerksamkeit und Anerkennung aber im naturwissenschaftlichen verhafteten Mediziner- und Wissenschaftskreis seiner Tage massivste Ablehnung einbrachte. Ein Grund mit, weshalb der Jude Freud nie Professor wurde. Dass er, wo immer möglich, mit diesen technischen Begriffen arbeitete, erklärt sich also ganz einfach aus seiner Herkunft und Zeit, was Freud aber überwand – ein zu Harari Denken völlig konträrer Prozess.
Die Seele sei ein wissenschaftlich belegter Unsinn, weil man sie ja nicht gefunden habe, so Harari und viele andere. Umso mehr verwundert es einen, dass Harari urplötzlich diesen wissenschaftlich nicht belegbaren Bereich für sein eigenes (atheistisch-technisches) Menschenbild verwendet, wenn er auf die Vorstellung vom „globalen Arbeitsraum“ rekrutiert, den natürlich auch niemand finden oder naturwissenschaftlich beweisen kann. Seine umwerfende Erklärung: Das sei halt eine „Metapher“! – Aber warum kann die „Seele“ nicht auch eine Metapher für etwas sein, was sich der naturwissenschaftlichen, materiellen und objektiven Betrachtung einfach entzieht? Und da niemand das Entstehen von Bewusstsein erklären kann, muss Harari die längst überholt geglaubte animistisch-religiöse Vorstellung einer „Zauberhand“ reanimieren.
Und nicht anders verhält es sich bei den anderen großen Begriffen aus der Geisteswissenschaft wie „Empfindung“, „Verlangen“, „Bewusstsein“, dem „Selbst“. Abenteuerlich wird es beim „Selbst“, wo sich ja selbst eingefleischte Mystiker und Geisteswissenschaftler kaum konkreter dazu äußern können, denn dieser Themenbereich, den ich mit anderen Mystikern einschließlich dem meditierenden Harari für hoch relevant halte, ist einfach zu komplex, eher irgendwie ahnbar, aber kaum fassbar und schon gar nicht objektiv beweisbar. Das Herumgerede, das er da als kritische Betrachtung von sich zu all diesen großen geisteswissenschaftlichen Themen gibt, hält man ja kaum aus. Nur manchmal blitzt auf, dass er sich da völlig übernommen hat, wenn er z.B. zugibt, dass die Biochemie nicht erklären kann, wie die einzeln beobachtbaren Gehirnströme und Gehirnaktivitäten, die ihrerseits Algorithmen bilden, entstehen: „Das ist die größte Lücke in unserem Wissen über das Leben.“ – Ich darf hinzufügen: Die entscheidende Lücke! Vielleicht sollte er da mal die Theologen und Philosophen und Psychologen fragen.
Am Schluss seines Buches stellt er ja die große Frage, ob die von ihm zugrunde gelegte Dataismustheorie wirklich stimme? Hier, ab dieser Stelle, stand das eigentlich schon fest, und er hätte sich als Wissenschaftler die restlichen paar hundert Seiten sparen können.
Und noch ein Wort zu den Massen und kleinen elitären Kreisen, wo letztere – natürlich wieder unter Zuhilfenahme religiöser Gebote – oftmals gegen die Interessen der Massen ihre eigenen egoistischen Ziele durchsetzen können: Da sollte er mal die massenpsychologischen Werke, z.B. von Freud oder dem Nobelpreisträger Elias Canetti lesen, bevor er so etwas in eine eher marxistische, weitgehend antireligiöse Geschichtsphilosophie einbaut.
Dass Sinngeflechte im Kontext von objektiven, subjektiven und intersubjektiven Wirklichkeiten entstehen, ist nachvollziehbar. Dass die Naturwissenschaften (bei Harari im Wesentlichen Biowissenschaften) im Bereich der objektiven Realitäten arbeiten, sollte klar sein. Was können sie auch zur subjektiven Realität eines Individuums oder einer Gesellschaft sagen? – Nichts! Da sind dann die Geisteswissenschaften gefragt, in deren Bereich sich die Auseinandersetzung mit subjektiven und intersubjektiven Realitäten vollzieht, vollziehen muss, da diese Bereiche der Objektivität naturwissenschaftlicher Wissenschaft nicht zugänglich sind und dennoch variabel und anpassungsfähig bleiben müssen. Dabei geht es nicht um objektive „Fakten“, sondern um Meinungen, Einstellungen und Haltungen. Sie bilden den Wesenskern einer jeden Gesellschaft. Und diese sind und waren „subjektiv“ und damit sind sie im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Fakten variabel und veränderbar und können und müssen interpretiert, diskutiert und der jeweiligen Zeit angepasst werden. So verändern sich philosophische, soziologische und religiöse Konzepte, - Veränderung heißt aber noch lange nicht, dass sie verschwinden, wie das Harari gerade bei den klassischen Religionen immer wieder postuliert. Dass „Gott tot ist“ (Nietzsche) ist ein unfrommer Wunsch, ist „Fiktion“, die sich selbst in autoritären atheistischen Ländern ganz offensichtlich bis zur Stunde nicht bewahrheitet hat, auch wenn Harari später behaupten wird, „Gott ist tot – es dauer(e) nur eine Weile, den Leichnam loszuwerden.“
Wenn Religionen oder Ersatzreligionen wie der Humanismus den Menschen keinen Sinn mehr geben, droht ja der von Nietzsche prophezeite Nihilismus. Lässt sich dieser abwenden? – Darum geht es im Teil II (Kapitel 4 – 7, S. 243 – 342)
Seit 70000 Jahren produziere der Sapiens aufgrund seines Lebens in einer Dreifachwirklichkeit „fiktionale“ Geschichten. Dieser Prozess wurde durch die Erfindung der Schrift enorm beschleunigt. Mit der Schrift war vieles leichter und besser zu organisieren, vor allem dann, wenn der Inhalt der Schriftstücke auch stimmig war. Ein Bildungssystem, das die Leistung der Schüler:innen in Noten ausdrücke und damit auch Abiturprüfungen mit Noten produziere, würden aber von vorneherein falsche Ergebnisse liefern. Und auf der gleichen Ebene lägen die Heiligen Schriften, die mit ihren völlig falschen Antworten auf Fragen des Lebens die Gläubigen absolut in die Irre führen. Sie könnten das, einfach weil sie Autorität besitzen. Unter seinen Paradebeispielen findet sich der Paulussatz aus dem Epheserbrief (5,22): „Die Frau sei dem Mann untertan“.
Dann geht Harari dem Phänomen nach, dass es in menschlichen Gesellschaften trotz dieser völlig wirklichkeitswidrigen und dazu noch autoritären Vorgaben funktioniere. Ziemlich am Anfang seiner Erklärung findet sich folgender Satz, der einen aufmerksamen Leser total irritiert: „Menschen haben viele materielle, gesellschaftliche und seelische Bedürfnisse.“ „Seelische Bedürfnisse“ – obwohl es keine Seele gibt?
Ungeachtet dessen unterstreicht er, dass „Narrative“, „alternative Erzählungen“, Fantasiegeschichten oder „Fiktionen“ wirkmächtig und in gewisser Weise notwendig und sinnvoll seien. Aber „wenn wir vergessen, dass sie bloße Fiktion sind, verlieren wir den Bezug zur Realität.“
Und in diesem Zusammenhang setzt er sich mit der „falschen Definition von Religion“ auseinander. Der Glaube an übernatürliche Mächte, Götter oder Dämonen, sei obsolet geworden und zu modernen Religionsverständnis lediglich „optionale Ergänzung“. „Doch Religion wird von Menschen, nicht von Göttern geschaffen und definiert sich eher über ihre soziale Funktion als über die Existenz von Gottheiten. Religion ist jede allumfassende Geschichte, die menschlichen Gesetzen, Normen und Werten eine übermenschliche Legitimation verschafft.“ Damit erklärt Harari jede Weltanschauung zur Religion, den Buddhismus, Taoismus, Humanismus, Nationalismus, Kommunismus, Liberalismus …
In modernen Gesellschaften würden keine Fiktionen oder Fantasiegeschichten oder Ähnliches zugrunde gelegt, sondern wissenschaftliche Theorien, die den Menschen völlig unabhängig von einem Glauben helfen, z.B. Antibiotika, und so die Menschen „optimieren“ könnten, wenn diese die neuen Möglichkeiten nicht missbrauchen würden, was sie aber tun. „Der Aufstieg der Wissenschaft wird folglich zumindest einige Mythen und Fiktionen mächtiger als je zuvor machen.“ Der Fluch liege darin, dass sich „Wissenschaft und Religion wie in altes Paar“ verhalten. Und das alte Paar treibe sein Unwesen bis hinein in den Kommunismus, der parteiintern letztlich „die einzige wahre Religion ist“.
Von Religion zu unterscheiden sei „Spiritualität“, denn „Religion ist eine Übereinkunft, Spiritualität hingegen eine Reise“ auf ein unbekanntes Ziel hin. „Für die Religionen ist die Spiritualität eine gefährliche Bedrohung.“ Harari unterlegt das mit Luthers Kampf gegen den Ablasshandel. Aber am Ende werde die Arbeit solcher Reformer doch konterkariert.
Nachdem die Leser nach Hararis tiefgründigen Erklärungen „ein bisserl besser Bescheid wissen“, könne er das Verhältnis Religion – Wissenschaft wieder aufgreifen. Manche behaupten also, dass die Wissenschaft in moralischen Fragen die Religion zur Umsetzung brauche, andere hingegen, dass Religion und Wissenschaft „völlig getrennte Reiche“ seien. Letzteres finde sich z.B. in der „Konstantinischen Schenkung“ bestätigt, die schlichtweg eine Fälschung war. Damit oder mit der Haltung der amerikanischen Evangelikalen zur Abtreibung, manövriere sich Religion (verstanden als klassische Religion) selbst ins Aus.
Nach Harari habe die Wissenschaft vor 100 Jahren belegt, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen, also von Gott verfasst sei, sondern „von unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichsten Zeiten“ letztlich manipulativ geschrieben wurde. Und solche Manipulationen könne und müsse Wissenschaft schonungslos offenlegen.
Im Zusammenhang mit dem Wissenschaftler Sam Haris, wo es um die Religionen und das Glück geht, fällt dann wieder ein Satz, der beim aufmerksamen Leser große Fragezeichen auslöst, nämlich, „dass wir über keine wissenschaftliche Definition oder Messgröße für Glück verfügen“. Fragezeichen deshalb, weil er sich anfangs viele Seiten lang über das Glück ausgelassen und es auch definiert hat. Aber es kommt ihm an dieser Stelle völlig überraschend auf etwas ganz anderes an: „Ohne die Berücksichtigung religiöser Überzeugungen lässt sich die Wissenschaftsgeschichte somit überhaupt nicht verstehen.“ Das hänge damit zusammen, dass es der Religion um „Ordnung“ und der Wissenschaft um „Macht“ gehe. Weil die moderne Gesellschaft an die humanistischen Dogmen glaubte, stellten sie diese nicht in Frage, sondern „implementierte“ sie.
Nach diesem Versagen ist in Kapitel 6 die Schaffung eines „modernen Paktes“ als Aufgabe, als „Vertrag“ der Moderne vorgegeben. „Der gesamte Vertrag lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Menschen stimmen zu, auf Sinn zu verzichten und erhalten im Gegenzug Macht.“ Die moderne Kultur lehne „einen großen kosmischen Plan“ ab und man stimme überein, das Leben kenne keinen Sinn. Folglich: „Wir können tun, was wir wollen – vorausgesetzt, wir finden eine Möglichkeit.“ Und „eines Tages“ erreichen wir damit schnellere Verkehrsmittel, bessere Medizin, „das Elixier ewiger Jugend, das Elixier wahren Glücks … - und kein Gott wird uns aufhalten“.
Mit der größer werdenden Macht werde auch das Wirtschaftswachstum größer, das „einen beinahe religiösen Status erreicht habe. Tatsächlich könnte man den Glauben an das Wirtschaftswachstum durchaus als Religion bezeichnen“. Der dahinterstehende Kapitalismus verspreche „Wunder hier auf Erden“. „Erstes Gebot“ des Kapitalismus sei in Wachstum zu investieren.
Harari fragt sich natürlich, ob „die Wirtschaft tatsächlich ewig wachsen“ könne? Ressourcen, Energie (und Wissen) seien grundlegende Faktoren der Wirtschaft und daraus resultiere als „Angstgegner“ der modernen Wirtschaft (…) der ökologische Kollaps“. Und jetzt kommt Harari mit der Umweltkrise, die weitgehend tabuisiert werde. Kritik sei deshalb am Kapitalismus angebracht, aber er habe auch „Vorzüge und Errungenschaften“. So seien Hunger, Krankheit und Krieg überwunden.
Anmerkungen
Harari tut sich manchmal unheimlich leicht, komplexe Systeme einzudampfen, zu beurteilen, bzw. zu verurteilen. Ich bewundere ihn einerseits für diesen unbedarften Zug. So weiß er, dass Noten im Schulsystem falsch sind und die Falschen damit belohnt werden. Da ist sich die Pädagogik aber nicht so einig. Ich kann nach Jahrzehnten langer Tätigkeit als Realschullehrer der Notengebung viel Gutes abgewinnen. Und auch bei der Abtreibung hat er eine klare Bewertung: Die von bestimmten kirchlichen Gruppen (vor allem den Evangelikalen in den USA) abgelehnte Abtreibung sei in jeder Situation das gute Recht jeder Frau. In einem System, in dem jeder und jede machen kann, was er/sie will, naheliegend. In einem System, wo auch Ungeborenem menschlichen Leben ein Wert zugesprochen wird, sieht das anders aus.
Und dann kommen – wie oftmals bei Harari – alte religionsfeindliche Kamellen. Ephesserbrief (5,22): „Die Frau sei dem Mann untertan“. Dass solche Bibelstellen heutzutage von vielen Theologen auf dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte ganz anders interpretiert werden, entgeht ihm. Überhaupt scheint er sich mit der Entwicklung in den Religionen und vor allem in der christlichen Theologie nicht beschäftigt zu haben. Da kommt er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mit dem Flehen der doofen Gläubigen nach Regen oder anderer Unterstützungen daher und weist darauf hin, dass die Wissenschaft längst bewiesen hat, wie Regen entsteht und kein Gott dahintersteht. Dass es für Menschen in zurückliegenden Epochen aufgrund ihres damaligen, längst überholten naturwissenschaftlichen (!) Wildbildes naheliegend war, hinter dem Schöpfer auch den Regenmacher zu sehen, ist doch nachvollziehbar. Und wenn man bedenkt, was für Unsinn „die Wissenschaft“ in ihrer Geschichte schon losgelassen hat, - das fängt bei denen an, die Gold machen wollten, die aufgrund Descart´scher Überzeugungen an lebenden Tieren ohne Betäubung völlig gefühllos wie an Algorithmen herumgeschnippelt haben (was Harari scharf kritisiert), über die Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates und hört noch lange nicht bei den Atomphysikern auf, die der Welt mit dem Segen der Atomenergie die Lösung für ihren Energiehunger versprachen. Und nennen müsste man auch die radikal wirkenden chemischen Mittel, die die chemische Industrie den Landwirten als Lösung ihrer Probleme aufgeschwatzt hatte und deren gefährlichen Reste man selbst nach jahrzehntelangem Verbot im Grundwasser findet. Wenn man sich einmal mit der Medizingeschichte beschäftigt und die ganzen Irrungen und Wirrungen bewusst gemacht hat, sollte man eigentlich als Geisteswissenschaftler mit zeitgebundenen Aussagen von Gläubigen und aus der Theologie auch zeitgebunden umgehen. Und wenn man dann noch die überzeugende Hilfe des totgeglaubten Gottes bei vielen Menschen bis in unsere Tage hinzunimmt – etwa bei Dietrich Bonhoeffer, der mit Gottvertrauen und Gelassenheit in den Tod und nach seiner eigenen Meinung damit ins Leben hineinging, - dann sollte man mit historischen Aussagen von Gläubigen etwas vorsichtiger und sensibler umgehen und aufhören bei jeder Gelegenheit Religion und Glaube letztlich unsachlich lächerlich zu machen und in den Dreck zu ziehen.
Dazu kommt, dass sich Harari offensichtlich nicht mit der historisch-kritischen Exegese der modernen, wissenschaftlichen Theologie beschäftigt hat. Denn dann wüsste er, dass dieser Prozess nunmehr seit 300 Jahren – und nicht seit 100 Jahren – läuft und dass diese Entwicklung aus der Theologie heraus in aller Regel von gläubigen Menschen getragen wurde und wird. Und weil aufgeklärte Theologen um den historischen Entstehungsprozess der Bibel wissen, interpretieren sie diese auch auf diesem Wissenstand, so wie sich Soziologen oder Philosophen auf dem heutigen Stand ihrer Wissenschaft bewegen und nicht für jede überholte Position aus ihrer Wissenschaftsgeschichte verantwortlich zu machen sind.
Der zentrale Punkt aber ist sein Religionsverständnis. Im Grunde genommen sei jede Weltanschauung Religion. Damit gibt es einen Berührungspunkt zum Verständnis von Theologen, die manche Konstrukte ohne übernatürlichen Gottesbezug oder Transzendenz als „Ersatzreligionen“ bezeichnen. In solchen Ersatzreligionen können einzelne Personen durchaus Götterstatus bekommen, wie Hitler oder Stalin, deren Ideologien dann quasi als gottgegeben und unverrückbar hingenommen werden (müssen). Solche Ersatzreligionen verbreiten dann eine unhinterfragbare Ideologie, an die sich alle halten (müssen). Bei Harari wird das, wie wir noch sehen werden, der Dataismus und das „System“ sein. Und solche Systeme haben Macht über Tod und Leben, bis hin zur Degradierung oder gar Auslöschung der Menschheit, eine Möglichkeit, die Harari am Ende von homo deus formuliert. Wer diese Kombination von Religion und Weltanschauung nicht erkennt, wird einmal Harari mit seinem Reden von Religionen zwangsläufig missverstehen und zum Anderen die politische Gefährlichkeit von Hararis eiskaltem Dataismus und dem unhinterfragbarem „System“ nicht erkennen.
Immerhin erkennt Harari die herausragende Bedeutung der Spiritualität an. Als Gläubige sind wir im Idealfall selbstverständlich auf der Reise und suchen Erfahrungen aus der Bibel mit unserem Erleben zu verknüpfen. Eigentlich tun wir nichts anderes. Dass er Luthers Kritik am Ablasshandel mit Luthers Spiritualität in direkter Beziehung setzt, trifft den Kern allerdings nicht, denn Luthers Kritik am Ablasswesen ist aus seiner Bibellektüre um die Auslegung der „Gerechtigkeit Gottes“ entstanden – aber das würde in Hararis Konzept ohnehin nicht hineinpassen.
Mit der erneuten Bezugnahme zum Thema Glück fühlt man sich etwas verschaukelt. Plötzlich kann die moderne Wissenschaft offensichtlich nichts Wesentliches über das Glück sagen, dabei war doch nach Harari klar definiert, dass Gück gute (körperliche) Gefühle seien, die sich auch durch Algorithmus-Beeinflussung mit biochemischen Stimulantien herstellen lassen. Das sind so Punkte, wo ich das Buch am liebsten weggelegt hätte, weil mit einer derartige Beliebigkeit ja nur schwer umzugehen ist.
Auch der Sinn muss nochmals herhalten. Harari postuliert einfach in der Moderne (vermutlich im Zeitraum bis heute): Das Leben kenne keinen Sinn. Und dass Hunger, Krankheit und Krieg überwunden seien, wie er behauptet, kann ich aufgrund meiner Wahrnehmung unserer Welt nicht bestätigen. Allein schon das Auftreten der Coronapandemie mit 6 bis 22 Millionen Toten (die Zahlen bewegen sich in diesem Bereich) nach der Herausgabe von homo deus setzt hier ein großes Fragezeichen.
Interessant ist auch die offensichtliche Verquickung von Wissenschaft(/Politik) und (klassischer) Religion. Dieses „Implementieren“ scheint ja auch für Harari zähneknirschend eine Realität zu sein. Wie er sich da rauswindet? – Man müsse solche Fiktionen kritisch betrachten, sonst verliere man den Bezug zur Realität. Ich habe eher den Eindruck, dass Harari mit seiner Engführung auf die biochemische Wissenschaft die Realität längst verlassen hat.
Mit einem genaueren Blick auf die revolutionäre humanistische Religion und Revolution geht der Husarenritt weiter. Nach dem modernen Pakt müsse man eigentlich einem Sinn im Leben abschwören. Aber es gebe eine „Ausstiegsklausel“.
Der Tod Gottes führte nicht zu einem gesellschaftlichen Zusammenbruch und Recht und Ordnung seien entgegen früherer Horrorannahmen nicht verschwunden. Dass das nicht passiert sei, liege daran, dass die humanistische Religion einen „revolutionären neuen Glauben“ etabliert hat, der die Menschheit anbetet. „Das Hauptgebot, das uns der Humanismus mit auf den Weg gegeben hat: Gib einer sinnlosen Welt einen Sinn.“ Der Glaube an Gott ging, der Glaube an die Menschheit kam. Mit Rousseau ebnet sich hier der Weg: „Hör auf dich selbst, folge deinem Herzen, sei dir selbst gegenüber aufrichtig, vertraue dir selbst, tu das, was sich gut anfühlt“ (im Druck als Zitat). „Der Humanismus hat uns beigebracht, dass etwas nur dann schlecht sein kann, wenn es dafür sorgt, dass jemand sich schlecht fühlt.“ Das versucht Harari mit Beispielen, die im Gegensatz zur Intention der Bibel (10 Gebote und 2. Mose 20,4 Bilderverbot) stehen, zu beschreiben. In diesem Zusammenhang kommt denn auch das Thema Homosexualität zur Sprache, für deren Stigmatisierung Harari das Juden- und Christentum verantwortlich macht. Entscheidend seien aber demgegenüber unsere Gefühle, bzw. die Gefühle homosexueller Menschen, und verallgemeinernd könne man sagen, dass unsere Gefühle unserem Privatleben und den gesellschaftlichen und politischen Prozessen Sinn geben. In moralischen Fragen gelte dann als einfache Richtschnur: „Wenn es sich gut anfühlt, dann tu es.“ (Im Druck in Anführungszeichen) Damit definiere sich auch die Kunst. In der Ökonomie habe der Verbraucher immer recht und in der Bildung würden Schüler nun endlich dazu angehalten, selbst zu denken. Damit veränderte sich nach Harari bereits der gesamte Kosmos. Und genau das hätte Nietzsche mit seiner Gott-ist-tot-These gewollt.
Wissen, verstanden als Formel („Wissen = empirische Daten x Mathematik“), sei in der modernen Gesellschaft eine zentrale Basis, komme aber „mit Fragen nach Wert und Sinn (…) nicht zurecht. Deshalb gab es eine Erweiterung um die Formel „Wissen = Erfahrung x Sensibilität“. Damit kommt der Erfahrungsbegriff in Blickfeld. Um aus Erfahrung und Sensibilität Gewinn zu ziehen, müsse der Mensch „empfindsam“ sein. So werde auch der Krieg durch diese letztere Formel verändert. Krieg sei nicht mehr das Spielfeld für Helden, Krieg sei nun „überall die Hölle“.
Leider habe sich der Humanismus aber in verschiedene „humanistische Sekten“, in den „orthodoxen Humanismus“, der dem Liberalismus anhing, den „sozialistischen „und den evolutionären Humanismus“ (zu letzteren zählt Harari die Nationalsozialisten und Adolf Hitler) gespalten. Alle gingen von der menschlichen Erfahrung „als oberste Quelle von Sinn und Autorität“ aus. Während die sanfteren Varianten des Nationalismus mit dem Liberalismus verschmolzen, habe sich der sozialistische Humanismus eher nach außen orientiert. Der nationale Sozialismus von Hitler sei dabei gewaltbereit aufgestellt gewesen. Aus diesen Gegensätzen entwickelten sich die „humanistischen Religionskriege“ (1914 - 1989), die mit dem Sieg von „Individualismus, Menschenrechten, Demokratie und freiem Markt“ endeten. Eine Bedrohung dieses Sieges gehe von China, weniger oder nicht vom Islam, „dem fundamentalistischen Christentum, dem messianischen Judentum und den hinduistischen Erweckungsbewegungen“ aus, denn das vermeintliche Comeback Gottes sei ein Trugbild. „Gott ist tot – es dauert nur eine Weile, den Leichnam loszuwerden.“ Doch Vorsicht sei geboten, denn: „neue Technologien töten alte Götter und gebären neue.“
Mit teils recht eigentümlichen Geschichtsinterpretationen zu Marx und Lenin, dem Sozialismus, dem Theismus, den Kirchen, dem Islam, modernen technischen Entwicklungen … verkündet er den Sieg des Liberalismus. „Die siegreichen liberalen Ideale drängen die Menschheit nun dazu, nach Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit zu streben.“ Doch gerade dieses Unterfangen komme durch die „neue posthumanistische Technologien“ ins Wanken.
Dann beschreibt Harari im Kapitel III „Homo sapiens verliert die Kontrolle“ (429 – 608) den Machtverlust des nur vermeintlich freien Menschen an die „Datenreligion“.
Die Annahme eines freien Willens sei falsch. „Als Wissenschaftler im Verlauf des letzten Jahrhunderts die Blackbox des Sapiens öffneten, fanden sie dort weder eine Seele noch einen freien Willen noch ein „Ich“ (Hervorhebung im Druck) – sondern nur Gene, Hormone und Nervenzellen, die den gleichen physikalischen und chemischen Gesetzen gehorchen wie der Rest der Wirklichkeit.“ Mit dieser funktionalen Gleichsetzung von belebten und unbelebten Teilen dieser Welt als einziger Wirklichkeit kommt Harari zu dem Ergebnis: „Das heilige Wort „Freiheit“ (Hervorhebung im Druck) erweist sich, genauso wie die “Seele“ (Hervorhebung im Druck), als leerer Begriff, der keine erkennbare Bedeutung hat. Der freie Wille existiert nur in den Geschichten, die wir Menschen erfunden haben.“ Und zu guter Letzt: „Den letzten Sargnagel für die Freiheit liefert die Evolutionstheorie.“
Daran schließen sich dann mehr oder weniger nachvollziehbare, eher philosophische Überlegungen an, mit denen er diese Behauptung belegen will. Wir würden nicht entscheiden, sondern „spüren“ und dann handeln. Es gebe kein „permanentes Ich“, sondern nur einen „Bewusstseinsstrom“. „Heute sehen wir, dass auch das Ich eine erfundene Geschichte ist, genauso wie Nationen, Götter und Geld.“ Und wenn dem so sei, können wir unsere Wünsche „mit Hilfe von Medikamenten, Gentechnik oder direkter Gehirnstimulation“ bestimmen. Und um das alles irgendwie zu managen, brauche es „ein ganz neues Paket religiöser Überzeugungen und politischer Institutionen“.
Anmerkungen:
Man kann sich nur wundern und ganz große Augen bekommen, wie naiv Harari seine Welt gestaltet, auch ohne Sinn. Wenn es keinen Sinn mehr gibt, droht der Nihilismus, was ja schon Nietzsche angekündigt hat. Aber das ist ja kein Problem, denn der Mensch gib einer sinnlosen Welt einfach einen Sinn, so als ob man da nur mit den Fingern schnipsen müsse. Bei dieser Sinngebung spielen Gefühle die zentrale Rolle. Das, was sich gut anfühlt, das ist Sinn. Natürlich bedarf dies einer gewissen Empfindsamkeit und man muss in gut romantischer Manier sich sehr genau selbst wahrnehmen. Doch dort, wo das geschieht, verändert sich alles, der gesamte Kosmos bis hin zum Krieg, denn da geht aufgrund der nunmehr veränderten Gefühlslage niemand mehr hin. Das ist in der Ukraine erfreulicherweise anders. Diese frappierend einfache Lösung kam durch den Humanismus in eine Welt ohne Sinn, die nun wieder einen Sinn hatte und hat. Überzeugend war diese neue Sinnfindung allerdings wegen des humanistischen Schismas (liberal, evolutionärer, sozialistisch) offensichtlich nicht, denn daraus entstanden die humanistischen Religionskriege von 1914 – 1989.
Natürlich waren mir die großen Kriege des 21. Jahrhunderts bekannt, aber nicht als Religionskriege. Selbst nach Harari waren ja die klassischen Religionen bereits auf dem Sterbebett. Und nach herkömmlicher historischer Sicht spielten bei diesen Kriegen die Religionen keine Rolle mehr. Die säkulare Menschheit war zunehmend am Start, atheistische Staatsführer und Reiche, die das Paradies auf Erden verheißen hatten, bekämpften sich mit nie dagewesener Brutalität und Grausamkeit. Warum also macht Harari diese Kriege zu Religionskriegen? Warum setzt er wie Trump an, die Geschichte umzuschreiben?
Mich hat die Einteilung des Humanismus als Religion von Anfang an irritiert, denn das sind ganz einfach Weltanschauungen mit bestimmten Werten und Überzeugungen, die aber nichts mehr mit Gott zu tun haben. Im Gefolge des Humanismus hat sich zunehmend eine säkulare Welt entwickelt, andere Strömungen taten das Ihre dazu. Irgendwie hat aber diese säkularisierte neue Weltsicht einer eher atheistischen Welt trotz tollster Einsichten und Errungenschaften nicht nur nach Harari offensichtlich nicht funktioniert, zumindest nicht so wie versprochen. Aber warum bezeichnet er solche Weltanschauungen als Religionen? Könnte es nicht so sein, dass Harari für das Ungenügen von Weltanschauungen eine eingängige Erklärung braucht? Und - nachdem die klassischen Religionen ohnehin als Feindbild bei ihm etabliert sind – entwickelt er das Narrativ, Weltanschauungen seien Religionen, die jetzt zwar in anderem Gewand daherkommen aber ungeachtet dessen systemimmanente Schwächen aufweisen, die den wahren Erfolg zwangsweise verhindern?
Die angeblich im Humanismus gewachsene Betonung von „Gefühlen“, „Sensibilität“ oder „Erfahrung“ sei im Gegensatz zu dogmatischen heiligen Schriften die Quelle der Erkenntnis und Toleranz. Und da darf natürlich die Homosexualität und deren Jahrtausende alte Verurteilung durch die Religionen nicht fehlen. Dass Wissenschaftler (!), Psychologen und Psychiater, bis in die 60ger Jahre des 20. Jhds hinein die Homosexualität als eine Art psychische Störung beschrieben haben, wird natürlich nicht erwähnt. Und dass in meiner ev.-lutherischen Kirche schon längst homosexuelle und schwule Pfarrer:innen arbeiten, und zwar nicht nur unter den zähneknirschenden Blicken der Gläubigen wie im Beispiel von Harari, auch nicht.
Die Hochachtung des Gefühls durch den Humanismus komme aber nach Harari mit all seinen Werten derzeit unter die Räder, da sich diese und andere längst überholten Werte naturwissenschaftlich in der menschlichen Blackbox nicht finden und schon gar nicht objektiv beweisen lassen: Seele, Freiheit, Nationen, Götter, das Ich und das Selbst. Damit befinden sich Seele oder Gott in zunehmend guter Gesellschaft, aber das ist sicher nicht Hararis Absicht. Er bereitet damit sein Menschenbild vor, dessen Zukunft nur im Dataismus liegen könne, der Mensch als Maschine, der Mensch als rein technisches Wesen, der Menschenautomat. Dass dieser Menschautomat zunehmend die Kontrolle verliert, weil richtige Maschinen, Apparate, Künstliche Intelligenz immer besser werden und schließlich die Führung über den doch sehr fehlerhaften und störanfälligen, religiös ausgedrückt „sündhaften“ Menschen aus Fleisch und Blut, angereichert mit paradoxen subjektiven und intersubjektiven Realitäten, übernehmen, liegt auf der Hand.
Beim Öffnen der Blackbox habe die Wissenschaft nur „Gene, Hormone und Nervenzellen, die den gleichen physikalischen und chemischen Gesetzen gehorchen wie der Rest der Wirklichkeit“ entdeckt. Sprich, all das, was den Menschen über das Materiell-Körperliche hinaus zum Menschen macht, Seele, Glaube, Freiheit, Geist, Bewusstsein, … kann die Naturwissenschaft nicht finden. Erstaunen!? Große Überraschung!?
Könnte das nicht ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass die Naturwissenschaften, mitsamt der Biochemie, eine sehr begrenzte Wahrnehmung haben und für das Psychische, Geistige, Spirituelle, Subjektive und Intersubjektive keine Sensoren besitzen? Dass da ganze Dimensionen der Wirklichkeit unter den Tisch fallen? Fällt diesen Technikern nicht auf, dass man zwar Synapsen entdecken, Gehirnströme messen, biochemische Aktivitäten belegen kann, aber keiner weiß, wer oder was diese letztlich steuert, so dass Bewusstsein (nach Harari eine Art „Luftverschmutzung“), Geist, Zeitgeist oder Ungeist, subjektive und intersubjektive und individuelle Wirklichkeiten (= offenbar nötige „Fiktionen“) entstehen? Ahnen diese Techniker nicht, dass sich damit die Frage nach Gut und Böse erledigt? - Wäre es spätestens hier nicht an der Zeit, die Scheuklappen abzulegen?
Die neuen grundlegenden Einsichten seit dem Öffnen der Blackbox seien gemäß Harari kein Garant für eine bessere Welt, denn diese Erkenntnisse können natürlich missbraucht werden. Er fragt aber nicht, was diesen Missbrauch bewirkt. Wenn er Freud gefragt hätte, wäre die Antwort ganz einfach: Es ist unsere zutiefst egoistische Grundstruktur, die uns über das Unbewusste oftmals einen Strich durch die Rechnung macht. Auf einer weniger tiefen Ebene zeigt sich das dann in dem, was Menschen wollen. Der menschliche Wille taucht aber in der Blackbox des Menschen auch nicht auf. Besitzt dann eine solche Fiktion menschlichen Willens biochemische Algorithmen, die sich über Psychopharmaka etc. steuern lassen? Da scheint Harari völlig unsensibel zu sein und präsentiert statt dessen die erweiterte naturwissenschaftliche Formel: „Wissen = Erfahrung x Sensibilität“. – Irgendwie grotesk, seit wann lässt sich denn Sensibilität in naturwissenschaftliche Formeln pressen? Und lässt sich denn „Sensibilität“ in der biochemisch untersuchten Blackbox des Menschen überhaupt finden?
Wenn man weiterdenkt und der angedeuteten Richtung folgt, dem „neue(n) Paket religiöser Überzeugungen und politischer Institutionen“, kann einem heiß und kalt gleichzeitig werden, denn wer definiert dann die Werte, die biochemisch und apparativ im neuen Menschenautomaten initiiert werden sollen? Trumps, Musks, Putins, Dawkins, Hararis, …? Wenn das weniger perfekte Menschen machen würden, die sich auf einen menschenfreundlichen, einfühlsamen Jesus Christus berufen, wäre mir ehrlich gesagt viel wohler dabei. Kein Wunder, dass - von Harari natürlich kritisiert - selbst die „Koryphäen der neuen wissenschaftlichen Weltsicht“ wie Richard Dawkins oder Steven Pinker, eigentlich seine Vordenker, ähnliche Bedenken äußern.
Oder braucht es keine Gefühle oder Werte mehr? Die Gefühle werden mit Psychopharmaka in die richtige Richtung gelenkt. Das würde viele Irrungen und Verwirrungen überflüssig machen. Nur wer legt die Richtung fest und wer sucht die Psychopharmaka aus und wer bestimmt deren Dosierung?
Im Kapitel 9 „Die große Entkopplung“ (469 – 538) und 10 „Der Ozean des Bewusstseins“ (539 – 562) will Harari drei Thesen untermauern:
„1. Die Menschen werden ihren wirtschaftlichen und militärischen Nutzen verlieren, weshalb des ökonomische und das politische System ihnen nicht mehr viel Wert beimessen werden.
2. Das System wird die Menschen weiterhin als Kollektiv wertschätzen, nicht aber als einzigartige Individuen.
3. Das System wird nach wie vor einige einzigartige Individuen wertschätzen, aber dabei wird es sich um eine Elite optimierter Übermenschen und nicht mehr um die Masse der Bevölkerung handeln.“
Harari weist drauf hin, dass „Hightech-Truppen“ an die Stelle von Massenarmeen treten werden. Auch in der Wirtschaft werde Intelligenz (KI) den Menschen ersetzen, so dass zentrale Entscheidungen ohne Bewusstsein erfolgen, denn im Computerwesen sind Intelligenz und Bewusstsein entkoppelt. Für Unternehmen bedeutet das: „Intelligenz ist unabdingbar, Bewusstsein hingegen optional.“ Damit würden „nicht-optimierte Menschen früher oder später völlig nutzlos sein“. Im Schach seien die Computer bereits dem Menschen überlegen, in vielen anderen Bereichen, der Medizin, bei den Apothekern, beim fahrerlosen Auto, in der Kunst, der Musik (selbst beim Komponieren), auch bei der Kundenbetreuung sei dies bereits integriert oder auf dem Vormarsch. „Nicht-organische Algorithmen“ würden „organische“ zunehmend überholen. Der Masse nutzloser Menschen werde dann einer winzigen Elite, die die Zügel in ihren Händen hält, gegenüberstehen. „Die(se) „nutzlose Klasse“ (Hervorhebung im Druck) wird nicht nur beschäftigungslos, sondern gar nicht mehr beschäftigbar sein.“ Für die Heiligkeit menschlichen Lebens, wie sie der Humanismus noch annimmt, wäre das ein „tödlicher Schlag“.
Der Mensch als In-dividuum (übersetzt „unteilbares Wesen“) sei eigentlich ein „Dividuum“ (übersetzt „ein Teilbares“), bestehend aus Algorithmen, denen eine „einzige innere Stimme oder ein einziges Selbst“ fehle. Und dieser Algorithmen-Mensch ist nicht frei. „Externe Algorithmen“, die mich besser kennen als ich mich selbst, könnten mich steuern. Der Mensch sei dann kein „autonomes Wesen“ mehr, sondern ständig überwacht und gelenkt. Eine Masse an biometrischen Daten würden den Menschen dann besser steuern, als er es selbst je gekonnt hätte. Jeder einzelne Mensch wäre dann ein „integraler Bestandteil eines riesigen globalen Netzwerkes“. Damit breche natürlich auch der Liberalismus zusammen. Die Computergesprächspartnerin Cortana übernehme die Führung. Die Mauer zwischen dem „Organischen und dem Anorganischen“ sei damit eingerissen. „Im Zuge dessen wird sich das Individuum als bloße religiöse Phantasie erweisen. Die Realität wird ein Mischmasch aus biochemischen und elektronischen Algorithmen sein, ohne klare Grenzen und ohne individuelle Knotenpunkte.“
Die Leitung übernehme dann „das System“ und damit sei die „postliberale Welt“ eingeleitet. Das System wiederum würde „eine kleine und privilegierte Elite optimierter Menschen bilden. Sie werden zentrale Dienste für das System leisten, während das System sie nicht verstehen und lenken kann.“ Und die nutzlosen Massen hätten das Nachsehen.
Im „Ozean des Bewusstseins“ (= Kapitel 10) würden „neue Religionen in Silicon Valley “für uns“ zusammengebaut, „die wenig mit Gott und alles mit Technologie zu tun haben.“ „Diese neuen Techno-Religionen lassen sich in zwei Haupttypen unterteilen: Techno-Humanismus und Datenreligion.“
Problem sei, dass wir über den „Geist nicht wirklich Bescheid“ wissen und wir in „einem riesigen Ozean fremder Geistzustände leben“. So kreiert Harari ein konzentrisches Bewusstseinsspektrum, in dessen Zentrum WEIRD-Personen (= Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic) stehen, dann kommen Menschen, dann Tiere, dann „alle möglichen Geisteszustände“.
Im modernen Menschen wären Fähigkeiten verkümmert, wie z.B. das Riechen, die Achtsamkeit oder das Träumen. Im einseitigen Techno-Humanismus könnte der Mensch sogar seinen Geist verlieren. Es käme zu einem „Downgrade“ vom „Schimpansen in verbesserter Ausführung“ hin zu „Ameisen in Übergröße“.
Der vom Techno-Humanismus hochgeschätzte menschliche Wille würde einer völlig „anderen Agenda“ weichen. Anstelle der Erfahrung als „höchster Quelle von Autorität und Sinn“ trete dann die „Information“. Und damit seien wir bei der „Datenreligion“ (Kapitel 11) angelangt.
„Der Dataismus bringe die beiden Entwicklungen (= Organismen sind biochemische Algorithmen und mit Hilfe der Computer können wir immer ausgeklügeltere elektronische Algorithmen entwickeln) zusammen und verweist darauf, dass für die biochemischen wie für die elektronischen Algorithmen genau die gleichen mathematischen Gesetze gelten.“ Die Grenze zwischen Organismen und Maschinen verschwinde damit. Es öffne sich der „Heilige Gral“ mit völlig neuen und einzigartigen Möglichkeiten. Die Datenverarbeitung revolutioniere die Welt. So hätte, ohne dass wir das gemerkt hätten, der Kapitalismus aufgrund seiner besseren Datenverarbeitung den Kalten Krieg gewonnen. Künstliche Intelligenz und Biotechnologie seien dabei Gesellschaft, Ökonomie, unseren Körper und unseren Geist zu überholen. Auch politisch werden wir dadurch überholt. „Gottgleiche Technologie und größenwahnsinnige Politik“ seien dabei ohne Zweifel als Horrorszenario denkbar. Aber es blicke ohnehin niemand mehr durch. So laufe das Ganze auf ein „Internet aller Dinge“ (Hervorhebung im Druck) zu. „Sobald diese Mission erfüllt ist, wird homo sapiens verschwinden.“
Der Dataismus mutiert zu einer Religion, „die für sich in Anspruch nimmt, über Richtig und Falsch zu bestimmen. Oberster Wert dieser neuen Religion ist der Informationsfluss.“ Es werde „praktische Gebote“ geben. So werde und muss alles miteinander vernetzt sein und die „größte Sünde“ bestehe darin, „den Datenfluss zu blockieren“. Völlig neue Werte würden entstehen, die über dem Recht der Menschen stehen. Und für diese Werte würden Menschen sterben; so gebe es bereits einen ersten Märtyrer des Dataismus.
Der Dataismus „missioniere“ mit seinen „enormen Vorzügen“, z.B. Krankheiten zu erkennen, Luftverschmutzung und Müll mit einem bestens organisierten, fahrerlosen Mobilitätssystem zu verringern. Eine „Privatsphäre“ gebe es allerdings nicht mehr.
So wie „Kapitalisten an die unsichtbare Hand des Marktes glauben, glauben Dataisten an die unsichtbare Hand des Datenflusses“. „Wenn das globale Datenverarbeitungssystem allwissend und allmächtig wird, wird die Verbindung mit dem System zum Quell des Sinns“. „Wer vom Datenfluss abgekoppelt ist, läuft Gefahr, den Sinn des Lebens zu verlieren.“ Deshalb müsse man alles (mit-)teilen (= „Grundmotto“).
„Der Dataismus ist weder liberal noch humanistisch. Er ist deshalb freilich keineswegs antihumanistisch.“ Menschliche Erfahrungen würden zwar zum „sentimentalen Humbug“ verkommen, „Autorität und Sinn“ kämen ins Wanken. Im 18. Jhd. ersetzte der Humanismus das deozentrische Weltbild durch das homozentrische. Im 21. Jhd. werde Letzteres vom datazentrischen Weltbild abgelöst, und das Hören auf die einstmals wichtigen Gefühle wird sich auf externe Algorithmen verlagern.
Damit stelle sich die zentrale Abschlussfrage mit direkt anschließender Beantwortung: „Wo aber kommen diese großen Algorithmen her? Das ist das Geheimnis des Dataismus.“ Schließlich hätten auch die Christen behauptet, man könne als Mensch den Plan Gottes nicht verstehen. „Der Ausgangsalgorithmus mag zunächst von Menschen entwickelt worden sein, aber wenn er heranwächst, verfolgt er seinen eigenen Weg und geht dorthin, wo noch nie zuvor ein Mensch war – und wohin ihm kein Mensch folgen kann.“
Abschluss: Ein Kräuseln im Datenfluss (603 – 608)
Ist das Leben wirklich „bloße Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung“? Diese Frage müsste man verifizieren. Und selbst wenn die Antwort ein klares Nein wäre, würde das nichts daran ändern, dass der Dataismus das Ruder übernehme und ggf. den überholten Menschenautomaten aussondere. Dem Menschen würde dann das blühen, was er in völliger Überschätzung als Krone der Schöpfung den Tieren angetan hat. „Rückblickend betrachtet, wird die Menschheit nichts weiter gewesen sein als ein leichtes Kräuseln im großen kosmischen Datenstrom.“
Vielsagend muten Hararis fast schon pastoralen Abschluss-Gedanken: er wolle mit diesem Buch den Horizont erweitern. Die Zukunft sei offen und nicht vorhersagbar. Aber folgende Prozesse würden alles überschatten (das Folgende alles im Zitat):
1) Die Wissenschaft konvertiert zu einem allumfassenden Dogma, Organismen seien Algorithmen und Leben sei Datenverarbeitung.
2) Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab.
3) Nicht-bewusste, aber hochintelligente Algorithmen könnten uns schon bald besser kennen als wir uns selbst.
Diese drei Prozesse werfen drei Schlüsselfragen auf, die Sie, so hoffe ich, noch lange nach der Lektüre dieses Buches beschäftigen werden:
1) Sind Organismen wirklich nur Algorithmen, und ist Leben wirklich nur Datenverarbeitung?
2) Was ist wertvoller – Intelligenz oder Bewusstsein?
3) Was wird aus unserer Gesellschaft, unserer Politik und unserem Alltagleben, wenn nicht-bewusste, aber hochintelligente Algorithmen uns besser kennen als wir uns selbst?
Anmerkungen:
Harari kommt zu der völlig neuen Einsicht, dass der Mensch kein Individuum sondern ein Dividuum ist. Sind das nicht Erkenntnisse, die z.B. im Konzept des inneren Teams von Schulz von Thun längst bekannt waren? Doch während Schulz von Tun mit diesem auf die Psychoanalyse fußenden Konzept umgeht und das Ganze praktikabel macht, zieht Harari daraus ganz andere Konsequenzen: Während machtgierige und absolut interessengeleitete Religionen, oder von Gott eingesetzte Herrscher, früher bestimmt haben, was gut und böse ist und das entsprechend geregelt haben, tun dies für das Dividuum ohne Freien Willen nun neutrale, unbestechliche elektronische Algorithmen. Die wichtigste und schwierigste Entscheidungsarbeit im Leben ist dem Menschenautomaten damit abgenommen. Bestens gesteuert, wenn auch von einer absolutistischen Elite, kann jetzt jeder und jede egal welchen Geschlechts nach der Weltanschauung oder besser nach der Religion des Dataismus leben. Der verhängnisvolle Start der Menschheit mit dem Apfel bei Adam und Eva und der Frage nach der menschlichen Reife ist endlich korrigiert! Niemand muss mehr wissen, was Gut und Böse ist. Einziger Wermutstropfen: Der Menschenautomat hat nichts mehr zu melden und eine Elite bestimmt, was gut und böse ist.
Der Menschenautomat ist entmachtet, wie die Masse, die immer wenig mächtig war. Mächtig waren die Priester und die Aristokraten und die gibt es ja noch, die Elite, die Oligarchen, die optimierten Übermenschen, die säkularen Oberpriester, die Trumps, die Putins, die Dawkins und die Hararis und …. Im Gewand einer neuen Ersatzreligion hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Und nach der „Gehirnwäsche“ (Harari verwendet diesen Begriff für andere Systeme) durch die neue Daten-Ersatz-Religion wird das u.U. auch klappen - wie gehabt.
Eine Wertschätzung der nutzlosen Masse fehlt. Die von ihm selbst geschätzten Werte wie Sensibilität, Empfindsamkeit, Spiritualität bleiben auf der Strecke. Ist Harari sich bewusst, welchen Frust er damit produziert und welches Leid er da billigend in Kauf nimmt?
Der Abschluss mit den drei Fragen mutet schulmeisterlich an und passt eigentlich gar nicht zu der neuen Pädagogik Hararis, nach der Schüler und Schülerinnen selbst denken lernen sollen, denn das zentrale Vehikel dazu sind Fragen, - und zwar Fragen, die man selbst stellt und nicht als Aufgaben gestellt bekommt. Die Frage, die sich bei mir nach dem Lesen des Buches stellte, war denn auch eine ganz andere, nämlich: Wo ist Harari falsch abgebogen? Ein paar Gedanken dazu habe ich ja immer wieder eingestreut.
Meine Hoffnung
Seit 3500 Jahren existiert der Hinduismus, seit 2500 Jahren versucht der Buddhismus seinem Gründer zu folgen, seit 2000 Jahren das Christentum Jesus Christus, - fehlerhaft, ohne Zweifel, Reformationen waren und sind immer wieder nötig, aber die Grundrichtung war klar. Menschlichkeit ist nicht vergessen, Menschenrechte und Menschenwürde sind zentrale Anliegen.
Die Aufklärung, m.E. die entscheidendste Weichenstellung der westlichen Welt, ist irgendwie in einer zur Religion erklärten Weltanschauung zugunsten naturwissenschaftlicher Fortschritte verschwunden. Sie taucht auch bei Harari explizit nie auf. Beim Abbau ihrer angeblich überholten Werte ist sie vielleicht nebulös zu ahnen, wenn überhaupt.
Das Gewissen oder die Entwicklung jeder einzelnen Person (im Sinne der Entwicklungspsychologie) spielen überhaupt keine Rolle, genauso wenig wie Einsatz für die Schwachen oder Nächstenliebe. Eiskalt, technisch, rein evolutionär. Im wahrsten Sinne des Wortes „formelhafte“ Sensibilität. Empfinden für das Leid von Menschen oder Tieren nur dort, wo es instrumentell gebraucht wird, um eine überholte Weltanschauung oder Religion schlecht zu machen oder wo man mit ersaufenden Ratten (mit Bildern!) chemische Stoffe entdecken kann, die den Menschen leistungs- und widerstandsfähiger machen. Mitgefühl für die nutzlosen Massen – Fehlanzeige. Lösungsversuche für das, was vor allem das Los der bis zu Ameisen degradierten Massen-Automaten angeht? – Nicht einmal im Ansatz.
Hunger, Kriege, viel Leid weltweit werden einfach relativiert und herabgespielt.
Was für ein Menschenbild begegnet uns hier im Menschenautomaten? Biochemie oben rein – funktionstüchtiger Mensch unten raus! Wie kann ein Mensch aus Fleisch und Blut ein derartiges Maschinendenken propagieren?
Sollte nach Harari der Staat nicht uns dienen? Das Fatum des Dataistenreligion sagt ganz klar, wer wem bis zur völligen Aufgabe zu dienen hat. Das „System“ hat es einfach so entschieden – basta! Es lebe die „Elite“. Trump & Co werden sich freuen und jubeln.
Wie kann ein Wissenschaftler, der die Steuerbarkeit von eigentlich allem, der auf naturwissenschaftliche Erklärbarkeit von allem pocht und mit einer eiskalten Objektivierbarkeit klassische Religionen und deren Gottesvorstellungen als völlig überholte und widerlegte Fiktionen darstellt, auf den letzten der 600 Seiten seines Werkes urplötzlich diese Grundsätze über Bord werfen und selbst auf ein nicht fassbares „System“ verweisen und das mit der Analogie zur christlichen Religion dazu noch rechtfertigen?
Gedanken eines Gurus, - hoffentlich nicht mehr.
Wenn der Pfarrer Martin Luther King im letzten Jahrhundert genauso fatalistisch gedacht hätte, wäre die rechtliche Gleichstellung der schwarzen Amerikaner vielleicht bis heute nicht in die Realität umgesetzt worden. Da hat einer für Menschen gekämpft, für menschliche Rechte und Werte. Und was macht Harari? Er erzählt von einem Schicksal, das wie ein böses Fatum unausweichlich kommen werde, statt Widerstand zu überlegen und sich für die bedrohten Rechte und die Würde von Menschen einzusetzen und ihnen Mut zu machen.
War da nicht was mit dem Recht auf Leben in den Allgemeinen Menschenrechten? Offensichtlich war auch das nicht allzu ernst gemeint. Immerhin wird zumindest die Elite gut leben. Ob ewig, so wie es sich für unsterbliche Übermenschen gehört, sei dahingestellt.
Tut mir leid, da gehe ich nicht mit.
Dr. theol Wolfgang Kornder
Erstellt: 250514
© Dr. Wolfgang Kornder